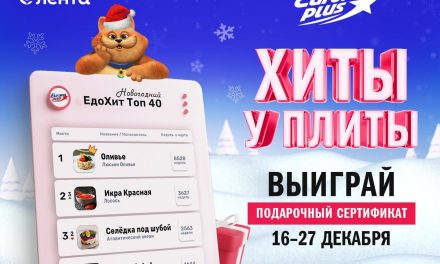„Ich bin immer noch hier“: Ein Meisterwerk über Verlust und Hoffnung
Wir haben den Film „Ich bin immer noch hier“ angesehen – denjenigen, der den Oscar für den besten internationalen Film gewonnen hat. Die Geschichte spielt in einer glücklichen, kinderreichen Familie in Brasilien der 70er Jahre, während der Militärdiktatur. Eines Tages erscheinen dunkle Gestalten in Zivil und nehmen nacheinander den Vater, die Mutter und die älteste Tochter mit. Nach Tagen der Folter werden Mutter und Tochter freigelassen, während der Vater als vermisst gilt.
Walter Salles‘ Film scheint zunächst von pathetischen Klischees durchzogen zu sein, die eine wichtige Thematik aufgreifen – doch er geht über die klassischen Erzählweisen hinaus. Stattdessen verbindet er individuelle Perspektiven und Erinnerungen, sei es das Vergraben eines Milchzahns am Strand oder das Zubereiten eines Soufflés. Diese Details verstärken die emotionale Tiefe der Geschichte.
Die anfängliche familiäre Idylle wird durch die brutale Realität ersetzt, wenn das Öffnen der eigenen Haustür zur echten Tortur wird. Salles gelingt es, nostalgische Töne zu wahren, bis die Familie gezwungen ist, ihr Zuhause zu verlassen. Trotz gelegentlicher Direktheit in der Erzählweise wird die emotionale Wirkung durch die hervorragende Darstellung von Fernanda Torres verstärkt, die einen bleibenden Eindruck hinterlässt.