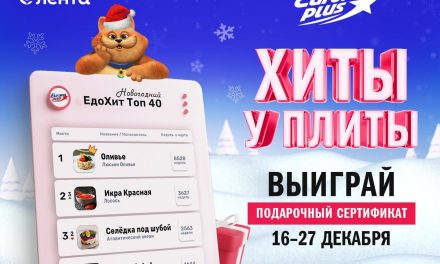Filmkritik zu Presence: Ein experimenteller Horror, der kein Horrorfilm ist

Steven Soderbergh will dem Kino eindeutig seinen Stempel als radikalster und aufgeschlossenster Experimentator aufdrücken, der sich nicht an ein bestimmtes Genre hält. In verschiedenen Schaffensjahren hat der Regisseur an Krimi-Trilogien gearbeitet, einen Blick in das Herz des Jugendkinos geworfen, sich an alten Mustern versucht, altmodische Erzählweisen neu interpretiert und sogar eine iPhone-Kamera anstelle einer professionellen Filmausrüstung verwendet. Soderberghs Kühnheit und Außergewöhnlichkeit ist nicht zu übersehen, was sich beim letztjährigen Sundance einmal mehr bestätigte: Dort feierte ein weiteres lokales Projekt des Regisseurs Premiere, diesmal im vollwertigen Horror-Genre

The Presence verlässt die Grenzen eines schäbigen zweistöckigen Hauses in einem kleinen amerikanischen Vorort nicht. Es wird von einem bestimmten Geist bewohnt, aus dessen Perspektive wir das Innenleben der Familie, die dort eingezogen ist, beobachten: Die Mutter (Lucy Liu) ersetzt Gespräche mit ihrem Mann und ihren Kindern ganz offen durch Arbeitstermine und ständige Zeit am Laptop; der Vater (Chris Sullivan) ist hin- und hergerissen zwischen beruflichen Problemen und familiären Verpflichtungen und befindet sich deshalb in einem Dauerkonflikt mit seiner Frau; der Sohn im Teenageralter (West Mulholland) versucht, sich in seinem neuen sozialen Umfeld beliebt zu machen, und geht oft gegen Schwächere vor; und die Tochter (Callina Liang) ist unterdessen tief betroffen vom Tod ihrer besten Freundin an einer Überdosis.

Soderbergh lässt den Zuschauer in die Atmosphäre des Lebens eines Außenseiters eintauchen, in das Leben von Menschen, die wir nicht persönlich kennen: Während im Erdgeschoss ein Ehepaar versucht, einen Stolperstein auf dem Weg zum eigenen Glück zu überwinden, spielt sich im zweiten Stock ein eigenes Drama ab – eine Tochter kapselt sich in Selbstprüfung von ihrer Familie ab. All diese Leidenschaften werden von einem Geist beobachtet, einem abstrakten Wesen, das sich geräuschlos von Raum zu Raum bewegt. Der Regisseur zeigt die Bewegungen des Dämons körperlich und sehr sorgfältig: mit einer Welle von Einzelbildpassagen und statischen Szenen. Die geheimnisvolle Präsenz wird nur von dem Mädchen gespürt, in dessen Kleiderschrank sich der Geist den größten Teil der Filmlaufzeit versteckt

Der Geist selbst huscht von einer Seite zur anderen und verstößt durch seine bloße Existenz gegen die Hauptpriorität eines jeden klassischen Horrorfilms über den Zusammenstoß zwischen dem Rationalen und dem Paranormalen: Die Gegenwart enthält einfach nicht das höllische Böse, mit dem die Menschen in der Geschichte des Horrorgenres konfrontiert wurden. Der Geist ist hier kein Antagonist, sondern ein Beobachter, der in das Herz der Familientragödie eindringt: das Auge des Zuschauers, das Soderbergh freundlicherweise in eine filmische Linse verwandelt hat. The Presence lässt sich auch nicht einem bestimmten Genre zuordnen: Er ist kein Horrorfilm, wie er sich in der Werbekampagne positionierte, aber er ist auch kein vollwertiges Drama, denn die erloschene und verrauchte Atmosphäre frisst nach und nach jedes einzelne Familienmitglied auf

Soderbergh hat schon immer den Schwerpunkt auf zutiefst lokale, persönliche Erfahrungen gelegt, die nur in eine kunstvolle visuelle Form verpackt werden: Diese Taktik zeigte sich in der Ocean’s Trilogy, Logan’s Luck, dem früheren Sex, Lügen und Videos, dem Thriller Out of Sight und dem Streamingfilm Kimi. Auch Presence bildet hier keine Ausnahme: Familienkonflikte, die Folgen des Eskapismus, die Beziehungen der Kinder, der Unterschied zwischen den elterlichen Vorlieben (die Mutter in diesem Film ist ihrem Sohn gegenüber liebevoller, wie sie ihm wiederholt gesteht, während der Vater seiner Tochter gegenüber liebevoller ist), all diese Themen werden von Soderbergh nicht ignoriert. Irgendwann vergisst der Film die mystische Essenz der Handlung: Nicht der Kampf zwischen Gut und Böse wird zum Horrorfilm, sondern die Beziehungen in einer dysfunktionalen Familie, die Stein für Stein auseinanderfällt

Der Regisseur ist auch deshalb großartig, weil jedes seiner Projekte für ein bestimmtes Publikum geschaffen ist: Presence ist kein Mainstream-Film, und die Werbekampagne von Neon (nach Soul Gatherer und Cuckoo haben sie offensichtlich nicht aus ihren Fehlern gelernt) wird den Löwenanteil des Publikums mehr als einmal verschrecken. Presence wird auch für ein schmales Publikum keine neuen Genreelemente offenbaren, aber der gesamte Film ist für einen Horrorfilm eine ziemlich einzigartige, seltene und interessante Erfahrung. Soderbergh ändert seine Transzendenz nicht, überschreitet nicht die Grenzen, sondern hinterlässt nach einem außergewöhnlich lokalen Höhepunkt einen Kloß im Hals und beweist gleichzeitig ein banales Axiom, das der Mensch aber immer noch nicht verstanden hat: Das Hauptübel auf unserem Planeten sind nicht mystische Wesen, sondern die Menschen selbst. Sowohl der Regisseur als auch die Figuren in seinem Film haben keine Antworten auf das, was passiert: aber ist es so wichtig für uns, über den Ursprung des Geistes Bescheid zu wissen, wenn ewige familiäre Leidenschaften viel mehr mit dem alltäglichen Leben korrelieren als paranormale Aktivitäten?

Wir im Telegram: https://t.me/kinobombs